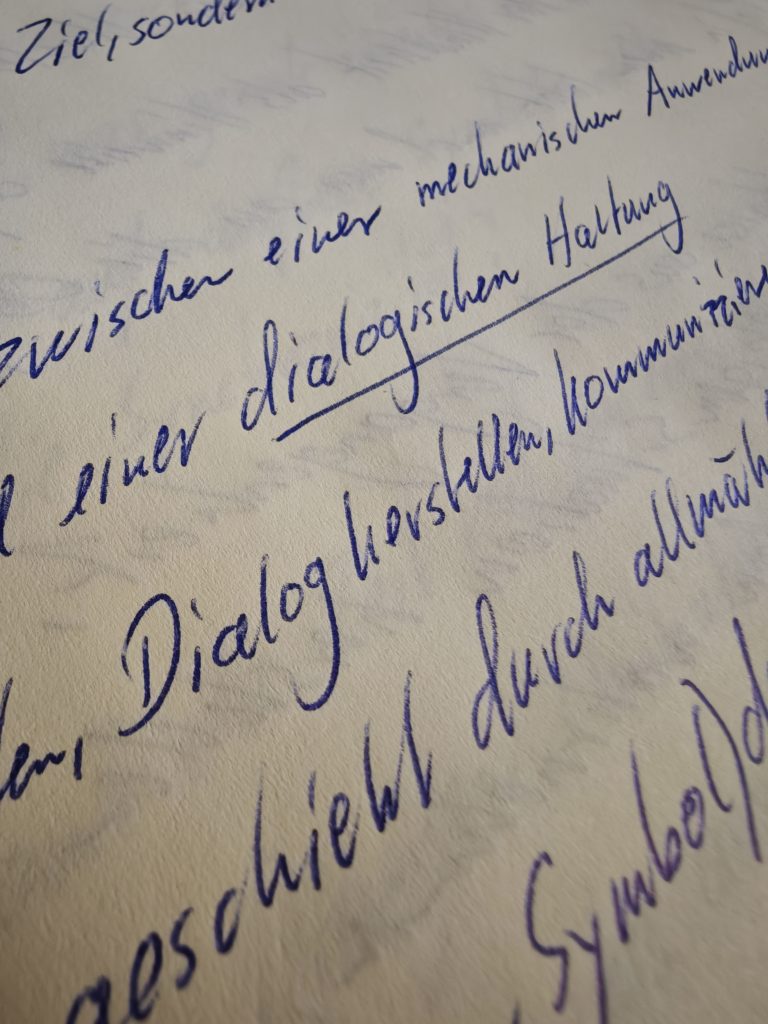“Durch die Supervision bei Benjamin Lang konnte ich meine eigenen persönlichen und beruflichen Ziele klar erkennen, so dass mir bewusst geworden ist, welche Weiterbildungen für meinen beruflichen Werdegang sinnvoll und erfolgversprechend sind. Diesen positiven Prozess unterstützte Benjamin Lang dadurch, dass er dem Gespräch eine gute Struktur gegeben hat, so dass ich meine eigene Lösung finden konnte. Diese wurde durch seine hohe Empathie und der Fähigkeit gut Zuhören zu können wesentlich gefördert.”
Jörg

Benjamin Lang – Brücke zwischen Innenwelt und Alltag
Ich bin Ben, 41, M.A. Coach, Supervisor, Organisationsberater (DGSv) und Dozent für Psychologie. Für Menschen mit privaten und beruflichen Anliegen, die bereit sind, in ihre Tiefe zu schauen. Durch Aktive Imagination und Hypnosystemik finden Sie Ihre eigenen inneren Ressourcen – wahrhaftig und eigenständig.
Was, wenn der Druck nicht nur von außen kommt – sondern ein Ruf deiner inneren Natur ist, endlich authentisch zu werden?
In Zeiten von Komplexität und ständiger Transformation
begegne ich in meiner Praxis immer wieder Menschen an einer bestimmten Schwelle:
Sie haben lange in Rollen funktioniert.
Sie spüren die Lücke zwischen Rolle und innerem Kern.
Und dann kommt diese eine, drängende Frage:
„Wer bin ich wirklich – jenseits meiner beruflichen Maske?“
Die überraschende Antwort: Diese Frage ist kein Problem. Sie ist der Beginn.
Mit fundierter hypnosystemischer Begleitung, der Methode der Aktiven Imagination und einem klaren Blick für die Integration ins reale Leben
unterstütze ich Sie dabei, die Brücke zwischen Innen und Außen zu bauen –
damit Sie nicht nur funktionieren, sondern aus sich selbst heraus wirken können.
Denn wahre Professionalität entsteht nicht durch mehr Technik,
sondern durch die Annäherung Ihrer beruflichen Rolle an das, was Sie im Kern sind.

professionelles Coaching
Bereit für Veränderung – aus dir selbst heraus.

Auf den Punkt genau
Strategien, die wirken – weil sie zu dir passen.

Dein Wegbegleiter
Veränderung als Chance – für dich, dein Team, deine Organisation.


“Mitmenschlichkeit, Haltung und Autonomie sind für mich grundlegende Werte, die eine optimale Entfaltung ermöglichen.”
Benjamin Lang, Coach
Was Du mit mir entwickeln kannst
Ob du vor einer konkreten Herausforderung stehst oder nur spürst, dass deine bisherige Form nicht mehr trägt. Meine Arbeit hilft dir, auf die Quelle deiner Stärke zuzugreifen – damit deine Wirkung authentisch und nachhaltig wird:
- Innere Dialoge führen lernen und mit dem Unbewussten in Kontakt treten
- Symbole als Kompass nutzen und die Antworten in sich selbst finden
- Das Unsichtbare verkörpern und tief und nachhaltig verändern
Gemeinsam gehen wir vom Reagieren ins Gestalten.
Coaching
Dein innerer Kompass für äußere Veränderung
Im 1:1-Dialog mit deinem Unbewussten findest du Antworten, die nicht nur funktionieren, sondern dich tragen – jenseits von Strategien, in der Begegnung mit deinen inneren Bildern.
Supervision
Wenn die Rolle zur Last wird – und der Weg zur Quelle führt
Für Therapeut:innen, Berater:innen und Coaches, die nicht nur Methoden anwenden, sondern aus einer Haltung heraus arbeiten wollen. Wir klären, was hinter schwierigen Fällen, Übertragungen oder eigenen Blockaden liegt.
Seminare
Innere Arbeit als Fundament äußerer Wirksamkeit In maßgeschneiderten Formaten erkunde ich mit Ihnen zusammen Ihre unbewussten Dynamiken – durch symbolische Arbeit, innere Dialoge und die Integration von Tiefe in den Alltag. Keine Tricks, sondern Transformation.
Kunden-Feedback
Werte und Vision
Menschliche Potenziale entfalten – für Organisationen, die Zukunft prägen
Meine handlungsleitenden Werte:
✅ Psychologische Sicherheit als Fundament für Innovation
✅ Proaktive Verantwortung statt reaktiver Kurzschlüsse
✅ Wissenschaftsbasierte Gestaltungskraft durch evidenzbasierte Methoden
Was mich antreibt
Eine Arbeitswelt, in der Menschen
– mit Autonomie statt Fremdbestimmung,
– durch Sinnhaftigkeit statt Kontrolle und
– mit mutiger Kreativität statt Angstlogik
wirkungsvoll gestalten – als Einzelpersonen, Teams und Organisationen..
Fachblog: Zukunftskompetenzen im Fokus
Wissenschaftlich fundiert, praxisnah umgesetzt
In meinem Blog teile ich evidenzbasierte Erkenntnisse und Methoden zu den Schlüsselkompetenzen für zukunftssichere Führung und Organisationsentwicklung – von emotionaler Intelligenz bis Innovationskultur.
-
16.02.2026
Fünf Monate im Gespräch mit meinem Unbewussten – und warum ich trotzdem manchmal ratlos vor meinen Bildern sitze
Mehr lesenSeit ich in einen bewussten Dialog mit meinem Unbewussten gehe, habe ich in wenigen Monaten mehr über mich gelernt als […]
-
12.02.2026
Innere Bilder als Frühwarnsystem
Mehr lesenManchmal tauchen Bilder auf, die nicht weggehen: ein endloser grauer Flur, eine schwere Tür, die sich nicht öffnen lässt. Solche […]
-
04.02.2026
Fünf Missverständnisse über innere Bilder – und was ich darunter wirklich verstehe
Mehr lesenViele Menschen spüren, dass innere Bilder in ihrem Erleben eine Rolle spielen – und sind gleichzeitig unsicher, ob das alles […]
Möchtest du mehr wissen?
Lass uns in Kontakt treten! Ruf mich an oder schick mir eine Nachricht.